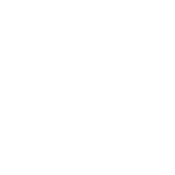Suchtkranke Eltern haben Kinder
"Suchtkranke Eltern haben Kinder" lautete das Thema der diesjährigen Mitarbeiterschulung (2006). Es schloss einen Zyklus von mehreren Themen ab, der sich in den vergangenen zwei Jahren mit der Tatsache beschäftigte, dass Suchterkrankung eine Familienerkrankung ist. Brigitte Sander-Unland konnte eine große Zahl interessierter MitarbeiterInnen der Freundeskreise begrüßen und führte dann einfühlsam in dieses nicht unproblematische Thema ein.
Auf den ersten Blick könnte der Titel dieser Mitarbeiterschulung belanglos wirken. Natürlich haben auch suchtkranke Eltern Kinder! Was soll daran besonders sein? Erst auf den zweiten Blick wird die Dimension dieses Themas deutlich. Es geht nicht darum, dass suchtkranke Eltern auch Kinder haben, sondern um die Frage, wie sich die Suchterkrankung der Eltern auf die Kinder, auf deren emotionale und soziale Entwicklung auswirkt. Wir, die TeilnehmerInnen dieses Seminars, haben unsere Suchterkrankung überwunden oder sind Angehörige eines, hoffentlich zufriedenen, abstinenten Suchterkrankten. Unsere Kinder sind möglicherweise schon erwachsen. Dennoch stellen wir uns immer wieder Fragen wie:haben die Kinder etwas von der Suchterkrankung gemerkt?
- Haben sie möglicherweise Schaden genommen in ihrer Entwicklung?
- Bin ich schuld daran, dass mein Kind drogenabhängig, psychisch labil...ist?
- Habe ich als Angehörige/r etwas an meinen Kindern versäumt?
- Was kann ich heute für meine Kinder tun?
- Lassen wir solche Gedanken oder Fragen überhaupt an uns heran oder wehren wir ab mit der Aussage: "Meine Kinder haben nie etwas gemerkt"?
Dieses Wochenende diente dazu, Hilfen und Anregungen zu geben, Mut zu machen, uns in unseren eigenen Familien und in den Gruppen mit diesen Themen zu beschäftigen. Es führte weg von der Selbstanklage hin zur Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte.
Am Samstag näherten wir uns in drei Phasen dem Thema an: Wahrnehmen - Verstehen - Handeln
1. Phase: Wahrnehmen
In dieser ersten Phase nahmen wir durch Übungen im Raum, durch das Zusammenstehen in verschiedenen Gruppen wahr, in wie vielen Rollen und Positionen wir von diesem Thema betroffen sind. Sind wir:
- Betroffene
- Angehörige
- Kind suchtkranker Eltern
- selbst Eltern
- Eltern von Kindern mit einer auffälligen sozialen oder psychischen Entwicklung
- Denken wir, unsere Kinder haben nichts mitbekommen?
- Haben wir mit unseren Kindern über unsere Suchterkrankung oder über die unseres Partners gesprochen?
Nach einem Lied der Gruppe "Licht" mit dem Titel "Mein Papa trinkt" und dem Film "Flaschenkinder" setzten wir uns, viele emotional sehr aufgewühlt, in Kleingruppen mit unseren Gefühlen zu diesem Thema auseinander.
2. Phase: Verstehen
Am Samstagnachmittag hielt Frau Hecht von der PSB Achern einen Vortrag, der die theoretischen Inhalte des Themas zusammenfassend beleuchtete:
In Deutschland wachsen derzeit über 2,5 Millionen Kinder in Familien auf, in denen mindestens ein Elternteil suchtkrank ist. Kinder von Suchtkranken sind stark in ihrer Entwicklung gefährdet. Forschungen haben ergeben, dass ein Drittel der untersuchten Alkoholiker einen Elternteil hat, der selbst alkoholabhängig war.
Sucht ist eine Familienkrankheit. Alle Kinder werden beeinträchtigt, wenn sie in einem süchtigen Umfeld aufwachsen. Jedoch können sie Fähigkeiten entwickeln, welche die Auswirkungen der Suchterkrankung in der Familie von ihnen abprallen lassen und die ihnen ermöglichen, mit den Schwierigkeiten des Lebens umzugehen. Eltern können diese Fähigkeiten bei ihren Kindern unterstützen und fördern; ein erster Schritt dazu ist, sich Hilfe zu holen und die eigene Suchterkrankung zu überwinden, denn:
- das Leben in einer Familie mit einem "nassen" Elternteil kann für alle Familienmitglieder zu großem Stress führen
- Kinder aus suchtbelasteten Fami-ien haben andere Lebenserfahrungen als Kinder aus herkömmlichen Familien
- Sie erleben andere Familienmitglieder oft als distanziert und kontaktarm
- Sie werden oft daran gehindert, in einer gesunden, altersentsprechenden Art aufzuwachsen.
Kinder aus suchtkranken Familien werden oft als vergessene Kinder bezeichnet. Vergessen sind sie vor allem deswegen, weil ihre Eltern mit ihrer Aufmerksamkeit vor allem um die Sucht kreisen. Der/die Süchtige richtet alle Aufmerksamkeit mehr oder weniger vollständig auf das Suchtmittel. Der nichtsüchtige Elternteil richtet alle Aufmerksamkeit auf den/die Süchtige/n. Auch professionelle Helfer konzentrieren sich meist auf den süchtigen Elternteil, haben oft keinen Blick auf die Not der Kinder.
In der alkoholkranken Familie bleibt für die Kinder oftmals kaum Raum für Zuwendung. Damit sie im System überleben können, nehmen sie verschiedene Rollenmuster an:
Held / Heldin
Übermäßig leistungsorientiert, überverantwortlich, abhängig von Zustimmung und Anerkennung, kann keinen Spaß empfinden
- Versorgt die Familie mit Selbstwert; ist das Kind, auf das die Familie stolz ist
Sündenbock / schwarzes Schaf
Zurückgezogen, voller Abwehr und Feindseligkeit, macht viel Ärger, wird evtl. kriminell
- Steht im Zentrum der negativen Aufmerksamkeit der Familie, lenkt vom suchtkranken Elternteil ab
Verlorenes / stilles Kind
EinzelgängerIn, TagträumerIn, einsam, wird übersehen, wird nicht vermisst
- Erleichterung für die Familie, wenigstens ein Kind, um das man sich nicht zu kümmern braucht
Maskottchen / Clown
Übermäßig niedlich, süß, nett, unreif, schutzbedürftig, ängstlich, hyperaktiv, tut alles um die anderen zum Lachen zu bringen und Aufmerksamkeit hervorzurufen
- Erleichterung und Spannungsabbau in der Familie durch Komik
In suchtbelasteten Familien lernen die Kinder in der Regel die drei ungeschriebenen Gesetze:
Rede nicht
Sprich mit niemandem über das, was in der Familie vorgeht
Vertraue nicht
Deine Wahrnehmung stimmt nicht. Nur was deine Eltern dir sagen ist wahr. (Also:"Papa hat nichts getrunken!"). Die suchtbedingte Unberechenbarkeit der wichtigsten Bezugspersonen vermittelt den Kindern, dass auf niemanden Verlass ist.
Fühle nicht
Verstecke deine Gefühle, wenn du dich fürchtest, traurig oder wütend bist. Für deine Gefühle gibt es keinen Grund, denn bei uns ist alles in Ordnung.
Solcherart irritierte Kinder stellen sich Fragen wie:
Was habe ich getan?
Bin ich Schuld, daß Papa / Mama trinkt?
Was habe ich falsch gemacht?
Kinder fühlen sich oft schuldig für das Suchtproblem in der Familie. Sie glauben, der Grund für das Unglück zu sein, das die Eltern immer wieder zum Suchtmittel greifen lässt. Daher versuchen die Kinder, sich ihren Eltern gegenüber genehm zu verhalten, um ihre Liebe zu erringen.
Nach diesem informativen Vortrag, der viele von uns sehr berührte, da er Erinnerungen an die eigene "nasse" Zeit hervorrief oder an die Zeit, als der/die PartnerIn noch getrunken hat, oder daran, wie wir selbst als Kind mit einem suchtkranken Elternteil lebten, beschäftigten wir uns mit der
3. Phase: Handeln
In Kleingruppen überlegten wir, was wir heute für uns und unsere Kinder tun können, um die Zeit der Suchterkrankung und deren Folgen aufzuarbeiten. Was können wir Hil-fesuchenden sagen, die als suchtkranke Eltern oder Angehörige zu uns in die Gruppen kommen?
Das sollten wir unseren Kindern sagen:
Sucht ist eine Krankheit
- Du hast sie nicht verursacht
- Du kannst sie nicht heilen
- Du kannst sie nicht kontrollieren
- Du kannst für dich selber sorgen...
- ...indem du über deine Gefühle mit Erwachsenen sprichst, denen du vertraust
- Du kannst gesunde Entscheidungen treffen - für dich
- Du kannst stolz auf dich sein und dich selber lieb haben
Die Ergebnisse der Kleingruppen zu den folgenden Fragestellungen:
1. Was können wir für uns selbst tun?
- zuhören
- Geduld haben miteinander
- Wissen, dass die Kinder Zeit brauchen
- Keine Schuldzuweisungen
- Den Begriff "Schuldgefühle" durch die Begriffe "Traurigkeit und Schmerz" ersetzen
- Schamgefühle abbauen
- Bei uns selbst ankommen
- Die eigenen Gefühle zulassen
- Wissen darum, dass Veränderung erst einmal mit Angst verbunden ist, diese Angst zulassen und trotzdem Neues wagen
2. Was können wir für unsere Kinder tun?
- ihren Weg begleiten
- Gesprächsbereit sein ohne Erwartungen zu haben
- Zuhören, spüren was das Kind braucht, dem Kind das Gefühl vermitteln, wahrgenommen und akzeptiert zu sein, so wie es ist
- Sich den Kindern als Mensch zeigen, mit Stärken und Schwächen
- Ehrlich, einschätzbar und verlässlich sein
- Fehler zugeben
- Über die eigenen Ängste reden
- Aufmerksam sein und signalisieren "Ich bin da wenn du mich brauchst"
- Von sich und dem Weg aus der Sucht erzählen, aber "Sucht" nicht allumfassendes und alleiniges Thema in Gesprächen sein lassen
- Wertschätzend den Kindern und sich selbst gegenüber sein und ein positives Vorbild geben
- Den Kindern die Erlaubnis geben, ihr eigenes Leben zu leben, sie aus der Verantwortung für uns entlassen
- Die Erlaubnis geben, mit anderen Personen über das Erleben in der eigenen Familie zu sprechen
- Nicht das Verständnis der Kinder für unsere eigene Suchterkrankung einfordern; wir, die Eltern, müssen Verständnis für unsere Kinder haben
- Verwöhnung aufgrund von Schuldgefühlen vermeiden
- Vater und Mutter sein, unabhängig vom Alter der Kinder
3. Was können wir in der Gruppe tun?
- Keine Angst vor diesem Thema haben, es immer wieder ansprechen, nicht nur einmal
- geduldig sein, Hoffnung geben und Mut machen, neues Verhalten auszuprobieren
- Erfahrungsaustausch
- Hilfsangebote machen
- Unsere Erfahrungen weitergeben
- Signalisieren, dass es nie zu spät für Veränderung ist
- Vorsichtig mit Neuen in der Gruppe umgehen, Verständnis zeigen und nicht überfordern
- Ermuntern, die Kinder in Vereine zu schicken
- Gemeinsame Unternehmungen im Freundeskreis, diese ermöglichen unbefangene Gruppenerlebnisse bei denen die Kinder Erfolgserlebnisse haben und Bestätigung erfahren
- Gemeinsame Feiern wie Weihnachten, Basteln usw.; diese Rituale vermitteln Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Akzeptieren, dass Kinder und Jugendliche mit zum Freundeskreis und zur Gruppe gehören
Im abschließenden Plenum wurde noch einmal deutlich, wie tief dieses Thema jeden einzelnen berührt hatte, da sich jeder in einer Rolle als Betroffener wiederfand: Selbst als Kind suchtkranker Eltern, als süchtiger Elternteil oder als Angehöriger. Uns wurde bewusst, dass dieses Thema in die Gruppenarbeit hineingehört. Es darf nicht aus Scham oder Schuldgefühlen verschwiegen werden. Wenn wir uns mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen und achtsam mit uns und unseren Familien umgehen, so wirkt sich das positiv auf unsere Beziehungen aus. Hierzu hat das Wochenende Mut gemacht. Handeln müssen wir, jetzt, in unseren Gruppen.
Zum Schluss möchte ich noch Virginia Satir zitieren, eine Mitbegründerin der systemischen Familientherapie:
Meine fünf unveräußerlichen Freiheiten:
Zu sehen und zu hören - was in mir ist, und mit mir ist, und nicht, was dort sein sollte, dort war oder vielleicht sein könnte!
Zu sagen - was ich fühle und denke, und nicht, was ich sagen sollte
Zu fühlen - was ich fühle, und nicht das, was ich fühlen sollte!
Zu fragen - was ich fragen möchte, und nicht warten, warten, warten auf Erlaubnis
Zu wagen - was mich reizt, statt immer nur "Sicherheit" zu wählen!
Ich probier`s einfach aus!
Barbara Kunz